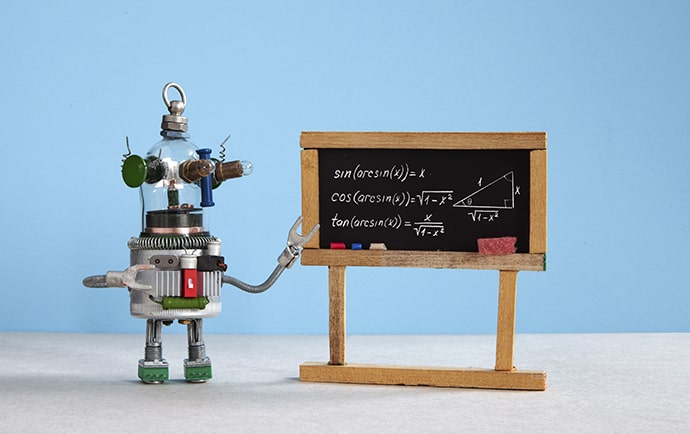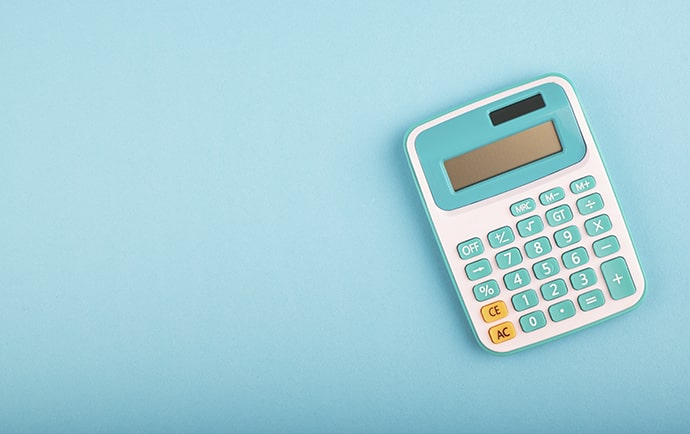Übersicht: Inflation in Deutschland
1. Aktuelle Inflationsrate
Inflation in Deutschland und der Welt
Die Inflationsraten in Deutschland und Europa sanken nach den Spitzenjahren 2022/2023 stark ab. In vielen EU-Ländern liegt die jährliche Teuerungsrate aktuell bei über 2 bis 4 %. Das ist weit entfernt von den teils zweistelligen Werten der Krisenjahre, aber immer noch über dem EZB-Ziel von 2 %. So betrug die durchschnittliche Inflationsrate im Euro-Raum im September 2025 2,2 %. In Deutschland lag die Inflation (VPI) im gleichen Zeitraum bei +2,4 %.
In den USA liegen die Teuerungsraten etwas höher bei 2,9 % (August), während China seit Anfang des Jahres mit negativen Inflationsraten kämpft (siehe Deflation).
Gründe für die moderaten, aber dennoch bedeutsamen Inflationsraten in Deutschland
Auch wenn die starken Preissteigerungen aus den Vorjahren (2021 bis 2023) abgeflaut sind, bestehen weiterhin Faktoren, die die Inflation im Blick behalten lassen:
Energiepreise
In Deutschland gingen die Energiepreise im September 2025 um -0,7 % zurück. Sinkende Energiepreise wirken dämpfend auf die Inflation insgesamt. Ein harter Winter könnte aber die europäischen Erdgasreserven aufbrauchen und zu stark steigenden Heizkosten führen, welche die Inflation neu befeuern werden.
Dienstleistungen
Trotz sinkender Energiepreise bleibt die Inflation bei Dienstleistungen über dem Durchschnitt. Im September 2025 stiegen Dienstleistungspreise gegenüber dem Vorjahr um etwa +3,4 %.
Zwar steigen die Löhne nicht mehr so rasant wie in Hochinflationsphasen, aber moderate Lohnsteigerungen sorgen dafür, dass sich die Dienstleistungsinflation nicht vollständig zurückbildet.
Globale Lieferketten & Rohstoffe
Zwar haben sich viele Engpässe entspannt, doch globale Risiken (z. B. geopolitische Spannungen) bleiben vorhanden.
2. Inflations-Prognosen 2025/2026
Wie sehen die Erwartungen für die kommenden Jahre aus?
- Für Deutschland erwartet die Deutsche Bundesbank eine durchschnittliche Inflation (HVPI) von etwa 2,2 % in 2025, anschließend Rückgang auf ca. 1,5 % in 2026. Stand Juni 2025.
- Laut dem ifo Institut wurde die Prognose für 2025 auf 2,1 % gesenkt, die Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) jedoch auf etwa 2,6 % angehoben.
- Für die Euro-Zone insgesamt sieht die Europäische Kommission 2025 eine Inflation von 2,1 % und von 1,7 % in 2026 voraus.
Was bedeutet das konkret für die Bauzinsen?
Die Europäische Zentralbank richtet ihre Zinspolitik weiterhin am Inflationsziel von rund 2 Prozent aus. Gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Lage – sowohl weltweit als auch in Europa – anfällig für Störungen und Unsicherheiten.
Da selbst die EZB und die US-Notenbank derzeit von einer außergewöhnlich hohen Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sprechen, lässt sich momentan keine verlässliche Prognose für die Bauzinsen im weiteren Verlauf des Jahres 2025 oder für 2026 treffen.
Kurz gesagt: ob die Kapitalmarkt- und Bauzinsen steigen oder fallen, ist derzeit reine Spekulation.
3. Bedeutung der Inflationsrate
Definition des Begriffes Inflation
Die Inflationsrate ist in Deutschland ein allgegenwärtiges Thema. Die Nachrichten berichten regelmäßig über die aktuelle Entwicklung. Bürger und Politik achten genau darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Hauptaufgabe der Preisstabilität nicht aus den Augen verliert. Es ist nicht nur die Angst vor Preisexplosionen, die die Bundesbürger so genau auf die Entwicklung der Inflationsrate schauen lässt, sondern auch ein deutsches Ur-Trauma.
Das Phänomen der Inflation stellt einen Forschungsgegenstand dar, der sowohl von Ökonomen als auch von Sozialwissenschaftlern bereits in unzähligen Veröffentlichungen diskutiert wurde. Trotzdem fehlt eine bis heute einheitliche Definition des Begriffes Inflation. Ursprünglich stand der Begriff für eine Aufblähung der Geldmenge. Im weitesten Sinne verstehen Wirtschaftswissenschaftler darunter einen anhaltenden Anstieg des Preisniveaus bzw. eines Sinken der Kaufkraft des Geldes.
Messen der Inflation
Es gilt zu beachten, dass im Falle einer Inflation nicht die Preise einzelner Güter steigen, sondern die Durchschnittspreise. Hierbei steht natürlich immer die Frage im Raum welche Güter in die Betrachtung der Durchschnittspreise aufgenommen werden. Zur Messung werden häufig Preisindices entwickelt, die auf den Lebenshaltungskosten oder auf den Großhandelspreisen basieren. Problematisch bei der Bildung von Preisindices ist im Allgemeinen die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Güter in Bezug auf die Gesamtheit der Produkte. Weiterhin zeigt der Kurs der betrachteten Währung im Vergleich zu ausländischen Währungen einen Kaufkraftverlust sowie einen Ansteigen des Preisniveaus an. Insbesondere im Falle von Lohn- und Preisfestsetzung nach oben gibt der Außenwert einer Währung Aufschluss über dessen Stärke und Wertentwicklung. In den folgenden Ausführungen wird vereinfacht vom Anstieg des Preisniveaus gesprochen.
Ermittlung der Inflationsrate in der Europäischen Union
Die Inflationsrate beschreibt das Ausmaß der Preissteigerungen in einer bestimmten Region. In der Vergangenheit nahm man hierfür einen Währungsraum. Die EZB hat beispielsweise die Aufgabe, die Inflationsrate für die Euro-Zone bei 2,0 Prozent zu halten. Gängig wird sie aber auch für die Nationalstaaten gemessen. Zudem unterscheidet man für bestimmte Teil-Preissteigerungen auch noch einmal Regionen in den Einzelstaaten. In Deutschland gilt dies beispielsweise für die Entwicklung der Mietpreise.
Ermittlung der Inflationsrate in Deutschland
Die deutsche Inflationsrate wird federführend vom Statistischen Bundesamt ermittelt. Grundlage ist der sogenannte Verbraucherpreisindex. Hierfür stellen die Statistiker fiktive Warenkörbe zusammen, welche die Waren und Dienstleistungen erhalten, die momentan von den Menschen in der Bundesrepublik am häufigsten erworben bzw. verbraucht werden. Insgesamt gibt es zwölf solcher Warenkörbe, deren Teilergebnisse am Ende in einem Warenkorb zusammengefasst werden. Das Statistische Bundesamt unterscheidet mehr als 700 Güter- und Dienstleistungsgruppen. Um die Preisveränderungen sichtbar zu machen, werden jeden Monat Stichproben von 188 Preiserhebern in mehr als 600 Gemeinden genommen. Das Statistische Bundesamt ermittelt allerdings nicht als einzige Institution die Inflationsrate in Deutschland. Auch die Bundesbank und die europäische Statistikbehörde Eurostat führen entsprechende Erhebungen durch. Dabei gibt es häufig Ergebnisse, die um zehn bis 20 Basispunkte voneinander abweichen. Dies hängt nicht mit dem Verfahren zusammen. Alle Erheber verwenden die sogenannten COICOP-Codes der Vereinten Nationen für ihren Warenkorb und setzen auf ein identisches Prozedere. Die Abweichungen hängen damit zusammen, dass unterschiedliche Gemeinden ausgewählt werden. In München sind die Preise höher als in einer Gemeinde in Brandenburg.
Im Gegensatz zu den veröffentlichten Preisentwicklungen lässt sich mithilfe eines persönlichen Inflationsrechners die individuelle Teuerungsrate ermitteln. Diese stellt in realistischer Weise die Veränderung des Realeinkommens des jeweiligen Haushaltes dar.
Erscheinungsformen der Inflation
Eine Inflation lässt sich zunächst nach dem Tempo des Preisanstiegs bzw. des Geldwertverlusts unterscheiden. Dabei spielen die nicht scharf voneinander abgegrenzten Begriffe schleichende, trabende und galoppierende Inflation (Hyperinflation) eine Rolle. Zunächst deutete die schleichende Inflation einen jährlichen Preisanstieg von 3 % bis höchstens 5 % an. Diese Angabe wurde aber seit den 70ern aufgrund des ansteigenden Preisniveaus ebenfalls nach oben korrigiert. Bei einer galoppierenden Inflation bzw. der Hyperinflation wird im Allgemeinen von monatlichen Preissteigerungsraten von 50 % oder höher gesprochen. Weiterhin tauchen Begriffe wie absolute und relative Inflation auf. Eine absolute Inflation repräsentiert dabei den Anstieg des Preisniveaus, wohingegen die relative Inflation ein Preisniveau für Güter anzeigt, die theoretisch niedriger liegen könnten, aber aufgrund von Produktivitätssteigerungen günstiger auf dem Markt angeboten werden.
Inflationen lassen sich zusätzlich nach der Dauer des Prozesses in eine chronische, einmalige und vorübergehende Geldentwertung differenzieren. Der einmalige Anstieg des Preisniveaus erfordert dem Wortsinn nach das Wiederabsinken des Preisniveaus. In Verbindung mit der schleichenden Inflation wird häufig ebenfalls von chronischer Inflation gesprochen, wenn eine nur mäßige jährliche Geldentwertung über einen längeren Zeitraum zu beobachten ist. Existieren in einer Volkswirtschaft von der Regierung verhängte Grenzen für Höchstlöhne oder –preise, so wird das reale Preisniveau unterschritten. Diese zurückgestaute Inflation lässt sich im Gegensatz zur offenen Inflation anhand der äußeren Währungsverluste sowie den Preisen auf dem Schwarzmarkt beobachten.
Historische Inflationsraten im Überblick
Deutschland wacht in der Euro-Zone wie kein anderer Staat über die Inflationsrate. Dies hängt mit dem Ur-Trauma von 1923 zusammen, als die Deutschen Bekanntschaft mit der Hyperinflation machen mussten. Das Geld verlor damals so schnell an Wert, dass die Geldscheine zuletzt mit Stempeln ihre neuen Werte erhielten, weil die Reichsbank mit dem Drucken nicht mehr nachkam.
Die neue Bundesrepublik setzte deshalb von Beginn an auf eine unabhängige Bundesbank, die sich dem Zugriff der Politik entzog, um zu verhindern, dass noch einmal „über die Druckerpressen“ finanzielle Engpässe gelöst werden sollten. Diese Einstellung gehört bis heute zur deutschen Staatsräson und schimmert immer wieder durch, wenn die EZB ankündigt, Staatsanleihen zu kaufen.
Die Inflationsrate in Deutschland war nach dem Krieg erst einmal sehr hoch, weil der Wiederaufbau vonstattengehen musste. 1951 betrug die deutsche Inflation beispielsweise 7,6 Prozent. Diesen Wert erreichte sie in die Geschichte nie wieder. In der Folge pendelte sie sich zumeist zwischen 2,0 und 3,0 Prozent ein. Eine Ausnahme waren die 70er Jahre. 1973 kletterte sie sogar noch einmal auf 7,1 Prozent. Auslöser damals war der Ölpreis-Schock. Zu Beginn der 90er Jahre stieg die Inflationsrate noch einmal signifikant an. 1992 erreichte sie 5,1 Prozent. Allerdings waren dies die Folgen der Wiedervereinigung. Die Preissteigerungen, die damals in der ehemaligen DDR passierten, waren dramatisch.
Unser Fazit
Die Inflation in Deutschland hat sich im Jahr 2025 deutlich beruhigt und nähert sich dem Bereich des von der EZB angestrebten Zielwerts von rund 2 Prozent. Dennoch bleibt die Lage fragil: Die Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) bewegt sich mit 2,8 % weiterhin oberhalb des Zielniveaus (September 2025). Dazu zeigt sich die wirtschaftliche Entwicklung nur schwach positiv.
Für Deutschland erwarten führende Wirtschaftsinstitute für das Jahr 2025 ein Wachstum zwischen 0,0 % und 0,4 %, 2026 soll es moderat anziehen. Damit erhoffte wirtschaftliche Erholung setzte sich bislang nicht durch. Die Gefahr einer Stagflation, also einer Kombination aus stagnierender Wirtschaft und gleichzeitig erhöhter Inflation, bleibt real.
Eine solche Situation stellt die Geldpolitik vor ein Dilemma:
- Senkt die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen, um die Konjunktur zu stützen, könnte dies die Inflation erneut anheizen.
- Erhöht sie die Zinsen, um die Inflation zu dämpfen, schwächt sie die ohnehin fragile Wirtschaft zusätzlich.
Vor diesem Hintergrund wird die EZB ihre Zinspolitik auch im Jahr 2026 sehr behutsam steuern. Ihr erklärtes Ziel bleibt, die Inflation dauerhaft nahe 2 Prozent zu halten, ohne die zarte konjunkturelle Erholung zu gefährden.
Was bedeutet das für Immobilienkäufer?
Die Phase stark steigender Bauzinsen scheint vorerst vorbei, doch eine Rückkehr zu den extrem niedrigen Zinsen der Vorjahre ist nicht zu erwarten. Stattdessen deutet alles auf eine stabilisierte Zinslandschaft hin. Mit moderaten, aber anhaltend schwankenden Konditionen, abhängig von globalen Ereignissen und geopolitischen Entwicklungen.